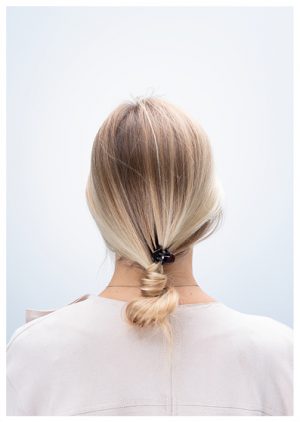Sans titre
En rêve, devant un café de Kantstrasse, j’explique à ma femme comment on écrit un texte. On doit s’approcher, dis-je, puis s’éloigner. Au réveil, je me dis que cette procédure est plus proche du film que de l’écrit, et qu’un film est plus anonyme qu’un texte. Même quand on connaît le nom du réalisateur, on n’a pas vraiment l’impression qu’il a fait le film. Dans un texte, c’est différent. Il y a un rédacteur qui se dit auteur et se met généralement en travers du texte. L’auteur embrouille le texte parce qu’il pense devoir s’immiscer dans le texte, et parce que le lecteur pense que le nom de l’auteur garantit un ordre symbolique, comme le nom du père. Mais l’auteur n’est pas un père, d’abord parce qu’au nom-de-l’auteur manque le désir de la mère. Et s’il représente un ordre, ce n’est jamais que celui du texte en question. Ensuite, cet ordre s’effondre. L’auteur ne peut garantir aucun ordre général, et c’est pourtant précisément ce qu’on attend de lui. S’il y avait vraiment un nom-de-l’auteur, ce serait le nom du texte en question. Il est donc logique que le présent texte, dépourvu de nom-de-l’auteur, soit dépourvu de titre. L’idée de la mort de l’auteur était compréhensible. C’était une tentative de revenir au texte. Mais si on déclare une chose morte, c’est qu’elle a vécu. En déclarant l’auteur mort, on déclarait qu’il avait existé. Et l’auteur, justement parce que déclaré mort, continuait d’exister. Certains affirmaient qu’il n’était jamais mort, d’autres qu’il avait ressuscité. Puisque le nom de l’auteur coiffe le nom du texte, les lecteurs pensent qu’il garantit l’ordre de ce texte. Un auteur n’écrivant généralement pas un seul texte, les lecteurs cherchent à comprendre les différents textes coiffés du nom de l’auteur comme un ordre unitaire garanti par ce nom. C’est pourquoi les lecteurs, enthousiasmés ou déçus par un texte, pensent que c’est l’auteur qui les a enthousiasmés ou déçus. La critique feuilletonnesque suit les mêmes prémisses, elle qui n’est pas en mesure de lire un texte. Tandis que l’auteur doit se battre contre le nom-de-l’auteur pour arriver à écrire un texte, le nom-de-l’auteur devient l’objet d’une critique qui en réalité ne critique pas le nom-de-l’auteur, mais le texte. La critique feuilletonnesque se trompe donc sur l’objet de sa critique. Sur le texte. Sur le nom-de-l’auteur. L’auteur cependant, pour arriver à écrire un texte, se bat non seulement contre le nom-de-l’auteur, mais aussi contre le sujet du quotidien qu’on appelle communément Je. La confrontation avec le sujet est immanente à son travail parce que c’est elle qui rend le texte possible. S’il ne se confronte pas avec le sujet, le texte échoue. Pour de nombreux auteurs, c’est trop compliqué. Ils s’accommodent de l’échec du texte. Plus ou moins consciemment. Ils disent ne pas être de grands théoriciens. Mais on n’a pas le choix. Je ne suis pas un grand théoricien non plus, mais je vois la nécessité de me confronter à ces questions pour rendre un texte possible. Peut-être certains auteurs ne veulent-ils pas rendre un texte possible, mais eux-mêmes. Peut-être pourrait-on diviser les auteurs entre ceux qui veulent rendre un texte possible et ceux qui veulent rendre eux-mêmes possibles. Certains veulent peut-être rendre une idée possible. Mais ces derniers ne sont qu’un sous-groupe de ceux qui veulent rendre eux-mêmes possibles. Une idée n’est souvent rien de plus qu’un accroissement de soi-même. Particulièrement quand on s’y accroche. Et pour rendre une idée possible, il faut s’y accrocher. Mais cela n’a rien à voir avec un texte, ou seulement dans la mesure où cela empêche le texte. La question intéressante n’est pas ce qu’est un auteur, mais ce qu’est un texte. Mais pour comprendre ce qu’est un texte, il faut d’abord comprendre ce qu’est un auteur. La question de l’auteur est donc intéressante en tant que question secondaire. Non pas qu’elle soit de deuxième rang, au contraire : il faut d’abord résoudre cette question secondaire pour pouvoir passer à la question primaire du texte. Chaque texte implique de répondre à la question secondaire de l’auteur pour pouvoir se tourner contre la persona de l’auteur et rendre ainsi le texte possible. On peut vouloir y couper, j’aimerais souvent y couper, mais on ne peut pas y couper si on veut rendre un texte possible et pas seulement soi-même. Tandis que je réfléchis à ce qu’est un auteur et ce qu’est un texte, à Klagenfurt un jury parle de textes et d’auteurs sans même effleurer ces problèmes. On croirait presque qu’ils n’en ont aucune idée. Ils parlent de textes avec un vocabulaire qui ne sait pas lui-même s’il décrit des textes ou des auteurs, et si ces auteurs sont des sujets ou les garants d’un ordre symbolique. On croirait qu’il s’agit de textes, mais il ne s’agit pas de textes. Ni d’auteurs. Car ces questions n’ont jamais été posées ni traitées. J’ignore ce qu’est un auteur, parce que je dois toujours découvrir qui est l’auteur d’un texte donné pour me tourner contre lui, afin que puisse naître le texte que, sans cela, l’auteur empêcherait. Les textes empêchés, c’est là la complexité, sont pourtant des textes plutôt que rien. À Klagenfurt, pour reprendre mon exemple, il y a des auteurs et des textes. Les auteurs sont là pour empêcher les textes. Le jury est là pour confirmer cette situation. C’est le contraire de ce dont il s’agit en littérature.